Der Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zum sogenannten Neukölln-Komplex hat in den vergangenen beiden Sitzungen Sachverständige angehört. NSU-Watch sprach mit Bianca Klose von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus (MBR) Berlin über das Gutachten der MBR (Bericht) im Ausschuss und die wesentlichen Erkenntnisse der MBR zum Neukölln-Komplex.
Du hast am 25. November das Gutachten der MBR im Untersuchungsausschuss vorgestellt. Wie war bisher dein Eindruck von der Arbeit des Ausschusses?

Bianca Klose (MBR). (Foto: Mang, MBR)
Dass der Ausschuss die Anhörung von Betroffenen an den Anfang setzte, ist nicht nur ein wichtiges Signal gegenüber ebendiesen Betroffenen, sondern auch der richtige Weg, um ihr Wissen und ihre Expertise über die Angriffe und die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden endlich angemessen einzubeziehen. Sie kritisieren jedoch die eingeschränkte Öffentlichkeit durch die Pandemiebestimmungen. Auch dass dem Ausschuss bisher kaum Akten zur Verfügung gestellt wurden, wird von einigen Betroffenen als bewusste Blockade interpretiert.
Wie kommt ihr im Gutachten zu euren Analysen und Einschätzungen?
Bereits ab dem Jahr 2001 wurde die MBR unter anderem aus der Neuköllner Zivilgesellschaft sowie der Politik und Verwaltung angefragt. Sie begleitete Akteure zu der Berliner Polizei, nahm an sogenannten Dialogformaten teil und hatte auf Einladung Einzelgespräche mit Abteilungen und verschiedenen Strukturen der Ermittlungsbehörden. Ab dem Jahr 2006 beriet und unterstützte die MBR dann die Gründung des zivilgesellschaftlichen Zusammenschlusses „Aktionsbündnis Rudow“ und begleitete es über zehn Jahre hinweg kontinuierlich. Auch die Britzer Initiative „Hufeisern gegen Rechts“ und das „Bündnis Neukölln“ beriet die MBR seit ihrer Gründung anlassbezogen. Anlassbezogen beriet die MBR ebenfalls „Die Falken“ in Neukölln seit Beginn der Bedrohungen und Angriffe, wie etwa im Fall der Brandanschläge auf deren Jugendeinrichtung „Anton-Schmaus-Haus“ im Jahr 2011. Die Engagierten organisierten viele Aktivitäten wie Demonstrationen, Kundgebungen und Demokratiefeste gegen lokale rechtsextreme Aktionen. Durch die Kontinuität, die Verlässlichkeit und die Qualität der Beratung konnte die MBR zunehmend Vertrauen und belastbare Beziehungen zu engagierten Einzelpersonen, Initiativen und Vereinen aufbauen. Durch ihren engen Kontakt zu den lokalen Akteuren erhielt die MBR präzise und aktuelle Informationen über Entwicklungen und Tendenzen der rechtsextremen Szene in Neukölln, die in das Gutachten eingeflossen sind, ebenso wie lokale Recherchen und Problembeschreibungen zu rechtsextremen Organisationen und zu den Erscheinungsweisen des Rechtsextremismus in Theorie und Praxis.
Euer Gutachten spricht von zwei Angriffsserien, einmal von 2009 bis 2015 und einmal seit 2016. Ihr kommt bei eurer Zählung auf andere Zahlen von Angriffen als die Behörden. Woran liegt das?
Seitdem wir Ende 2009 eine deutliche Zunahme an rechten Angriffen auf politische Einrichtungen in Berlin festgestellt hatten, die in den Ausführungen und bei den Zielen der Taten Ähnlichkeiten aufwiesen, haben wir gezielt solche Vorfälle gesammelt. Zum einen, um unsere Wahrnehmung mit Fakten und Zahlen zu belegen, zum anderen, um Muster feststellen zu können. Ziel war es, potenziell Betroffene zu warnen und sie zu beraten, wie man sich schützen kann, aber Ziel war natürlich auch, auf diesen unhaltbaren Zustand öffentlich hinzuweisen. Neben der Auswertung von öffentlichen Quellen flossen bei der Zählung der Fälle natürlich auch die umfangreichen Erkenntnisse aus unserer Beratungsarbeit ein
Euer Gutachten heißt „Vom ‚Nationalen Widerstand Berlin‘ zu rechtsextremen Angriffsserien“. Warum spielt das Label NW-Berlin, das ja seit etwa 2012 nicht mehr genutzt wird, so eine wichtige Rolle bei der Betrachtung des Neukölln-Komplexes?
Eine detaillierte Betrachtung des Neonazi-Netzwerks „NW-Berlin“ ist aus Sicht der MBR für das Verständnis der beiden Angriffsserien seit 2009 unerlässlich, weil sich einerseits Parallelen in der Wahrnehmung Betroffener über das behördliche Vorgehen feststellen lassen, andererseits eine Kontinuität in den Tatausführungen und den relevanten rechtsextremen Protagonisten auf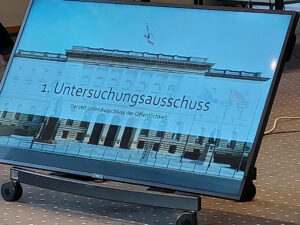 gezeigt werden kann. Die Fragestellungen des aktuellen Untersuchungsausschusses betreffen Rechtsextreme, mit denen sich das Abgeordnetenhaus schon vor zehn Jahren in unterschiedlichen Gremien im Zusammenhang mit „NW-Berlin“ beschäftigt hat. Uns stellt sich daher die Frage, ob die Serie rechtsextremer Angriffe bei konsequenterem Vorgehen gegen die Personen, die bei „NW-Berlin“ aktiv waren, frühzeitiger hätte beendet werden können – oder gar nicht erst möglich gewesen wäre. Aufgrund der Kontinuität der Angriffe seit 2009 und eines gleichbleibenden Musters im Vorgehen rechnet die MBR den Personen und dem Umfeld von „NW-Berlin“ einen Großteil der Taten der Angriffsserie zu. Diese Personen haben in dem Netzwerk ihre „Anti-Antifa“-Aktivitäten über viele Jahre hinweg weitgehend ungestört professionalisieren können und einen Modus Operandi entwickelt, den wir bis zuletzt beobachten konnten. Die Angehörigen des Netzwerks waren von Beginn an auf politischen Gegner*innen fixiert, über die Jahre hinweg konnten sie ungestört ihr Vorgehen in der Recherche, im Ausspähen von Betroffenen sowie in der Ausführung der Anschläge verfeinern. In dieser Zeit operierten die Rechtsextremen geradezu routinemäßig mit gesprühten Drohungen an Hausfassaden, Stein- und Farbflaschenangriffen bis hin zu Brandstiftungen an Häusern und Kfz. Am Anfang wurde bei einem Teil der Taten sogar das gesprühte Label „NW-Berlin“ ähnlich einem Bekennerschreiben hinterlassen. Die Behörden begriffen „NW-Berlin“ damals nicht als militantes Neonazi-Netzwerk, sondern lediglich als Webseite. Wir sehen darin eine verpasste Chance. Es drängt sich der Eindruck auf, dass ausbleibende Ermittlungserfolge die Rechtsextremen in ihrem Handeln jahrelang ermutigt und bis heute ein Gefühl der Unangreifbarkeit erzeugt haben.
gezeigt werden kann. Die Fragestellungen des aktuellen Untersuchungsausschusses betreffen Rechtsextreme, mit denen sich das Abgeordnetenhaus schon vor zehn Jahren in unterschiedlichen Gremien im Zusammenhang mit „NW-Berlin“ beschäftigt hat. Uns stellt sich daher die Frage, ob die Serie rechtsextremer Angriffe bei konsequenterem Vorgehen gegen die Personen, die bei „NW-Berlin“ aktiv waren, frühzeitiger hätte beendet werden können – oder gar nicht erst möglich gewesen wäre. Aufgrund der Kontinuität der Angriffe seit 2009 und eines gleichbleibenden Musters im Vorgehen rechnet die MBR den Personen und dem Umfeld von „NW-Berlin“ einen Großteil der Taten der Angriffsserie zu. Diese Personen haben in dem Netzwerk ihre „Anti-Antifa“-Aktivitäten über viele Jahre hinweg weitgehend ungestört professionalisieren können und einen Modus Operandi entwickelt, den wir bis zuletzt beobachten konnten. Die Angehörigen des Netzwerks waren von Beginn an auf politischen Gegner*innen fixiert, über die Jahre hinweg konnten sie ungestört ihr Vorgehen in der Recherche, im Ausspähen von Betroffenen sowie in der Ausführung der Anschläge verfeinern. In dieser Zeit operierten die Rechtsextremen geradezu routinemäßig mit gesprühten Drohungen an Hausfassaden, Stein- und Farbflaschenangriffen bis hin zu Brandstiftungen an Häusern und Kfz. Am Anfang wurde bei einem Teil der Taten sogar das gesprühte Label „NW-Berlin“ ähnlich einem Bekennerschreiben hinterlassen. Die Behörden begriffen „NW-Berlin“ damals nicht als militantes Neonazi-Netzwerk, sondern lediglich als Webseite. Wir sehen darin eine verpasste Chance. Es drängt sich der Eindruck auf, dass ausbleibende Ermittlungserfolge die Rechtsextremen in ihrem Handeln jahrelang ermutigt und bis heute ein Gefühl der Unangreifbarkeit erzeugt haben.
Das Anlegen von Feindeslisten und allgemein die „Anti-Antifa“-Strategie ist ja eine spätestens seit den 1990ern bekannte Strategie der Neonazi-Szene. Warum ist sie aber gerade in Berlin-Neukölln so dominant als Praxis der Szene?
Das Ausspähen der Adressen von Personen, die Rechtsextreme für politische Gegner*innen halten – ob engagierte Journalist*innen, Gewerkschafter*innen, Kommunalpolitiker*innen oder Antifa-Aktivist*innen – ist in der Tat seit Jahrzehnten gängige Praxis und Teil einer als „Anti-Antifa-Arbeit“ bezeichneten Strategie. Sie ist zudem fester Bestandteil neonazistischer Aktionsformen, die auf das Ausspähen folgen und bis hin zu rechtsterroristischen Gewalttaten reichen. Gezielt werden Gerichtsprozesse besucht und Akteneinsichtsrechte in Ermittlungsverfahren genutzt, oder es wird versucht, sich Zugang zu den Kundendaten von Versandunternehmen zu verschaffen, die Produkte gegen Rechtsextremismus vertreiben. Auch private Post aus dem Briefkasten wurde von Rechtsextremen bereits entwendet. Es sind ferner Einzelfälle bekannt, in denen Rechtsextreme ihre Tätigkeit in Behörden mutmaßlich dazu nutzten, sich Zugang zu personenbezogenen Daten von politischen Gegner*innen zu verschaffen. Die über Generationen hinweg gewonnenen Informationen fließen in sogenannte Feindeslisten ein. Diese meist arbeitsteilig zusammengetragenen Feindeslisten werden teilweise intern geführt, teilweise aber auch veröffentlicht und etwa über Soziale Medien und Messenger-Dienste verbreitet. Die Veröffentlichung und sichtbare Feindmarkierung soll die Betroffenen zum einen einer diffusen Bedrohung aussetzen, zum anderen dienen diese Listen aber mutmaßlich auch der Vorbereitung von konkreten Straftaten. Von den 116 Betroffenen, welche die MBR darüber informiert haben, dass sie auf einer dem Tatverdächtigen T. zugeordneten Feindesliste aufgeführt sind, waren 33 Personen bereits auf Internetseiten des militanten Neonazi-Netzwerks „NW-Berlin“ namentlich erwähnt gewesen, und wiederum zwölf von ihnen waren bereits persönlich von Anschlägen betroffen.
Einerseits ist die Bekämpfung abweichender Meinungen immer ein immanenter Bestandteil rechtsextremer Ideologie. Und häufig lässt sich dabei eine Fokussierung auf den Sozialraum beobachten, auch in Neukölln – Stichwort „Rudower Spinne bleibt schwarz-weiß-rot“. Berlin weist aber noch weitere Besonderheiten auf. Wir gehen davon aus, dass die starke zivilgesellschaftliche und antifaschistische Präsenz in der Stadt der rechtsextremen Szene kaum andere Optionen lässt, als sich am politischen Gegner abzuarbeiten. Ein ungestörtes Agieren wurde den Rechtsextremen regelmäßig verunmöglicht, sie waren stets mit Ablehnung konfrontiert und agierten aus einer Position der politischen Schwäche. In Neukölln gibt es zudem Protagonisten, deren politischer Schwerpunkt die „Anti-Antifa“-Arbeit teilweise schon seit Jahrzehnten gewesen ist. Die verbringen einen großen Teil ihrer Zeit nur mit solchen Aktivitäten.

Kundgebung vor dem Abgeordnetenhaus
Es tauchen ja immer wieder die gleichen Namen aus der Neonazi-Szene auf, wenn es um den Neukölln-Komplex geht. Warum kam es bei einem derart begrenzten Kreis infrage kommender Täter dennoch kaum zu Ermittlungserfolgen der Polizei?
Diese Frage lässt sich recht gut am Beispiel der Ermittlungen zu „NW-Berlin“ beantworten: Aus Sicht vieler Betroffener wurde seitens der Polizei ungenügend zur Feindesliste auf der „NW-Berlin“-Webseite ermittelt. Ihren Aussagen wurde vielfach nicht geglaubt und ihren Hinweisen oftmals nicht nachgegangen. Ein Zusammenhang zwischen dem Ausspähen, dem Sammeln von personenbezogenen Daten sowie der teilweisen Veröffentlichung und den späteren Anschlägen wurde seitens der Strafverfolgungsbehörden offenbar nicht gesehen. Öffentliche Informationen sowie Einschätzungen von antifaschistischen Gruppen und Beratungsprojekten wurden über einen langen Zeitraum ignoriert. Zivilgesellschaftliche Projekte begannen deshalb, ihre Bewertungen durch Veranstaltungen und Pressearbeit öffentlich zu machen. Im Rechtsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses wurden Einschätzungen vorgestellt, wobei den Strafverfolgungsbehörden vorgehalten wurde: Entweder sie hatten weniger Wissen als die Zivilgesellschaft, oder sie führten ihre Informationen zu keiner brauchbaren Analyse zusammen, oder sie blieben aus unbekannten Gründen untätig. Der öffentliche Druck bewirkte letztlich ein offensiveres staatliches Vorgehen und die Abschaltung der „NW-Berlin“-Webseite, allerdings wurde bis heute niemand verurteilt.
Zwei wichtige Erkenntnisse zu Feindeslisten und zu Drohschmierereien waren pure Zufallsfunde. So wurde zum Beispiel eine Liste nur zufällig bei einer Hausdurchsuchung durch den Zoll gefunden. Zwei Täter – Sebastian T. und Oliver W. – wurden beim Schmieren von Drohparolen gefilmt. Die Überwachungsmaßnahme richtete sich aber nicht gegen die Neonazis, sondern gegen die von den Drohungen betroffene Person. Das zeigt eine falsche Prioritätensetzung durch Ermittlungsbehörden. Wie schätzt ihr die Rolle der Ermittlungsbehörden, insbesondere des Berliner LKA, ein?
Wir sehen das ambivalent. Der BAO Fokus des LKA wurde von den Sonderermittlern großer Fleiß bei der Ermittlungsarbeit bescheinigt und es sei vielmehr die Staatsanwaltschaft gewesen, die den Seriencharakter zu spät erkannt habe. Diese BAO entstand jedoch erst gegen Ende der Angriffsserie und ihre Ermittlungstätigkeit können wir mangels Aktenkenntnis nicht einschätzen. Hier ist der Untersuchungsausschuss gefragt. Dass es sich bei dem lange gesuchten Beweismittel nun um ein reines Zufallsprodukt des Vorgehens gegen Angehörige der linken Szene handelt, wirft Fragen zur Verhältnismäßigkeit des Ressourceneinsatzes der Berliner Polizei auf. Vielleicht haben die Ermittlungsbehörden aber auch Beweismittel zur rechtsextremen Angriffsserie zurückgehalten, um die Informationsgewinnung in der linken Szene weiterführen zu können. Wenn sich das bewahrheitet, wurde der Quellenschutz mal wieder höher bewertet als der Schutz potenzieller Opfer. Es scheint, als wären zentrale Konsequenzen aus der Mordserie des NSU nicht gezogen worden. Zwei Jahre mussten verstreichen, damit ein seit Jahrzehnten aktenkundiger Rechtsextremer von den Ermittlungsbehörden auf dem Video identifiziert werden konnte. Wertvolle Zeit, in der die Täter wieder hätten zuschlagen können. Und warum war die aufgezeichnete Tat nicht Gegenstand der Anklage der Generalstaatsanwaltschaft gegen O.W. vor dem Amtsgericht Tiergarten? Das ist ein Thema unseres Gutachtens.
Was außerdem bekannt ist, das ist der Umgang mit den Betroffenen, denen vielfach nicht geglaubt oder zugehört wurde. Außerdem wurden die von ihnen angestrengten Verfahren zeitnah eingestellt. Wir haben auch Kenntnis, dass Beweismittel nicht gesichert wurden, dass es anscheinend Kontakte von Polizist*innen in die rechte Szene gab. Außerdem sind uns dienstlich unbegründete Datenabfragen aus Polizeicomputern bekannt, in einem Fall bei einer Person, die kurz darauf von Anschlägen an ihrer neuen, nicht öffentlich bekannten Wohnadresse betroffen war.
Was müsste der Untersuchungsausschuss deiner Ansicht nach vor allem untersuchen, um wirklich für Aufklärung zu sorgen?
Der Ausschuss muss die Arbeit von Polizei, Justiz und Verfassungsschutz untersuchen und sich den zahlreichen offenen Fragen im Neukölln-Komplex stellen. Wurde alles Notwendige getan, um Verantwortliche der rechtsextremen Angriffe zu ermitteln? Gab es ein grobes Verschulden der Behörden? Vor allem die Betroffenen wollen wissen, welche Erkenntnisse die Behörden im Vorfeld von Anschlägen hatten, ob Ermittlungen verschleppt wurden, ob bestimmten Hinweisen einfach „nur“ nicht nachgegangen worden ist, oder ob gar Aufklärung aktiv behindert wurde oder die Täter*innen gar interne Informationen erhalten hatten.


